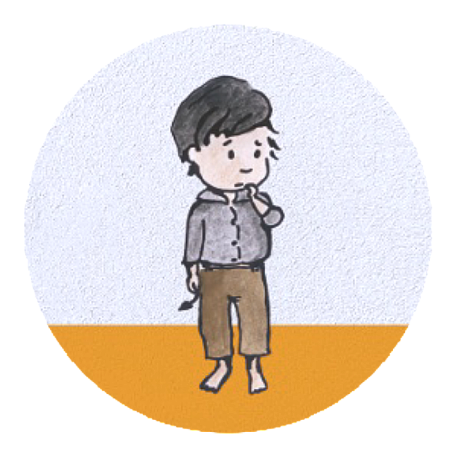Devlin
In einem ländlich (und weltlich) abgeschiedenen, katholischen Waisenhaus in Flandern lebte ein kleiner Junge. Er war zehn Jahre alt, mochte süßes Gebäck und Fußball und las gerne Abenteuergeschichten. Er lebte schon lange dort, so lange, dass er sich nicht mehr an andere Orte erinnern konnte. Seine Eltern waren gestorben, als er vier Monate alt war. Sie waren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ihn hatte man ins Krankenhaus gebracht. Überhaupt hatte er viel Zeit in Krankenhäusern verbracht. Verreist war er noch nie, und er hatte den Traum aufgegeben, irgendwann einmal fortzugehen, so wie er die Hoffnung aufgegeben hatte eine Familie zu finden. Keine hatte ihn jemals haben wollen. Auch nicht, als die meisten vergessen hatten, wer (oder besser: was) er war. Die Nonnen hatten es ihnen zugeflüstert. Die anderen Kinder waren irgendwann adoptiert worden und weggegangen. Er aber war immer geblieben.
Sein Name war Devlin, und er war ein Teufelchen.
Gibt’s nicht? Auf jeden Fall war Devlin der Junge, der vor zehn Jahren Schlagzeilen als Hellboy gemacht hatte, weil er mit einem Schwanz auf die Welt gekommen war. Hörner hatte er nicht, auch keinen Pferdefuß. Er war auch nicht rot oder hatte ein Fell, aber er hatte einen mittlerweile 35cm langen Schweif mit einer gezackten Spitze. Seine Eltern hatten ihn geliebt (das hoffte er jedenfalls) und hatten ihn stolz der Welt präsentiert. Er hatte seinen eigenen Instagram-Account, bevor er krabbeln konnte. Und einen YouTube-Channel. Seine Eltern hatten Bilder aus dem Krankenhaus gepostet von einem blutigen Bündelchen, bei dem Nabelschnur und Schwänzchen kaum zu unterscheiden waren, und später von einem in ein weiches Nici-Tüchlein gerollten Wesen. Sein unterer Rücken mit dem ungewöhnlichen Auswuchs war in den meisten zu sehen. Es gab Fotos von einem Zuhause, an das sich Devlin nicht erinnern konnte, von einem bäuchlings schlummernden Baby mit hellem Haar und einem Schleifchen am Schwanz. Es gab auch Fotos, auf denen er angezogen war, aber auf denen war er einfach ein normales Baby, und sie hatten nicht so viele Likes bekommen. In den Videos schlief er in der Regel, in einem wurde er gebadet und hielt seinen Schweif in der Hand. Es waren harmlose Zeugnisse einer unfreiwilligen Medienpräsenz und eines anderen Lebens. Mit dem Tod seiner Eltern hatte Devlins Leidensweg begonnen. Als klar war, dass er den Zusammenstoß unversehrt überstanden hatte, und, dass es keine weiteren Angehörigen gab, hatten sich Wissenschaftler auf das Teufelchen gestürzt, es untersucht und studiert und (als sie daran gescheitert waren es zu dressieren) aufgezogen. Nach zwei Jahren hatten sie das Interesse verloren und es eine Weile in Ruhe gelassen. Das Waisenhaus war seither sein Wohnsitz gewesen, und die Nonnen hatten sehr gut daran verdient, ihn an Ärzte und Scharlatane zu vermieten. Als er sechs war, größer und kräftiger als ein Neugeborenes, hatte die zweite Versuchsrunde stattgefunden. Devlin erinnerte sich an große Hände in stabilen schwarzen Gummihandschuhen, die ihn im Nacken packten, seine Ärmchen gegen den kalten OP-Tisch pressten oder seinen Schwanz betasteten. Immer und immer wieder. Sie hatten ihn gemessen, hatten an ihm gezogen bis die Wirbel ausgerenkt waren, hatten ihn gekniffen, mit Nadeln gestochen und Stückchen aus ihm herausgeschnitten. Devlin war in der Regel bei Bewusstsein gewesen – solange, bis der kleine Körper die Schmerzen nicht mehr ausgehalten hatte. Was sie dann mit ihm gemacht hatten, wusste er nicht genau, aber mehrfach war er mit Magenschmerzen aufgewacht; sein Gedärm hatte weh getan; andere Male war sein Hals wie geschwollen gewesen und er hatte nicht sprechen können. Bei mehr als einer Gelegenheit hatten sie ihm Zähne ausgeschlagen. Die Lücke vom letzten Mal war immer noch da. Er hatte auch andere Verletzungen gefunden. Pflaster hatten Einschnitte und Nähte verdeckt. Irgendwann waren sie verheilt, aber die Narben waren geblieben, und tiefer noch als die Wunden auf seiner Haut waren die Wunden, die all das auf seiner Seele hinterlassen hatten. Devlin fürchtete sich vor dem Einschlafen. Er fürchtete sich vor der Dunkelheit, vor dem Alleinsein, vor der Einsamkeit. Er fürchtete sich vor seinen Träumen, die in Wahrheit Erinnerungen waren. Er hatte Angst vor Männern in Arztkitteln und Frauen im Habit. Er hatte Angst vor anderen Kindern und ihrer Bosheit und Gefühllosigkeit. Er hatte Angst Fehler zu machen und Angst vor Strafen, Schlägen, Tritten, heißen Duschen. Er hatte Angst ausgelacht zu werden. Er wusste, dass er anders war, dass er weniger wert war als andere Kinder (das hatte man ihm oft genug gesagt), dass er hässlich war, dass er albern aussah mit seinen spitzen Eckzähnen und seinem Schwanz, dass er lächerlich war. Weil er nie biss, wenn sie an seinem Schwanz zogen oder ihm auf den Kopf schlugen. Weil er nicht kratzte, wenn man ihn festhielt oder trat. Weil er kein Feuer spie, wenn man ihn kränkte. Ein hilfloser kleiner Teufel, der eher zusammenzuckte als anderen Schaden zuzufügen. Er hatte Angst sich zu wehren, Angst davor, was kam, wenn er versuchte, die Dinge zu ändern. Angst. Angst. Angst. Die Angst ließ ihn wachbleiben, seine Fingernägel abkauen, seine Knie vor Nervosität zittern. Sie ließ ihn bei lauten Geräuschen erschrecken und bei Stille sein Herzchen rasen. Er war gefährlich, der Inbegriff des Bösen, und er würde töten, schänden und zerstören. Das hielten die Nonnen ihm tagtäglich vor, und Devlin fragte sich, ob er wirklich böse war und ob Gefahren von ihm ausgingen. Vielleicht war er tatsächlich ein Ketzer und Mörder. Diese Vorstellungen jagten ihm die größte Angst ein. (...)
„Essen ist fertig!“
Devlin hörte die Mutter rufen und rollte sich auf den Bauch, der nicht mehr wehtat. Schlecht war ihm auch nicht mehr, und er stellte mit Verwunderung fest, dass, obwohl er eingeschlafen war, nichts wehtat. Da waren auch keine neuen Verbände oder Pflaster. Wie lange mochte er geschlummert haben? Seine Nase fing feinste Essensdüfte auf. Tomate erkannte er. Und Zwiebeln. Möhren auch. Es roch köstlich, und er schob sich in den Sitz. Auf dem Bett hockend blickte er sich in seinem Zimmer um. Orange. Er atmete gleichmäßig und fühlte sich … geborgen. Als er Richtung Schreibtisch blickte, war da keine Lache Erbrochenes mehr. Stattdessen roch es nach frischen Zitronen. Seine Bücher und Stifte waren noch da, aber sein Jutebeutel war weg! Sein Lavendel, dachte Devlin und fühlte Panik in sich aufsteigen. Jemand hatte seinen Beutel fortgenommen. Die Gerüche aus der Küche ließen dem Teufelchen das Wasser im Mund zusammenlaufen, und es fragte sich, ob es nachschauen durfte, was es zu essen gab. Die Familie hatte ihm nicht gesagt, welche Bedingungen für ihn galten. Wann durfte er sein Zimmer verlassen? Ein leises Klopfen riss ihn aus seinen Gedanken, und er rief, „Ja?“ Angela steckte ihren Kopf ins Zimmer und grinste, als sie sah, dass er auf war, „Essen ist fertig. Komm‘!“ Der Junge starrte sie mit offenem Mund an. Er sollte der Familie beim Essen zusehen? Eigentlich hatte er dazu keine Lust, aber durfte er die Einladung ablehnen? Dann wären sie bestimmt ungehalten und würden ihn in den Keller sperren. Vielleicht reichte es schon, dass er jetzt trödelte, also sprang er vom Bett herunter und folgte dem Mädchen ins Esszimmer. Der Tisch war gedeckt, und in der Mitte stand auf einer Holzplatte eine große dampfende Auflaufform. Das Essen duftete wie damals bei dem Kindergeburtstag, und Devlin öffnete den Mund, so dass seine kleinen spitzen Zähne hervorlugten. Angela nahm gegenüber ihren Eltern Platz, und der Junge verharrte unentschlossen im Türdurchgang. „Geht es dir besser?“ fragte die Mutter, und er nickte und entschied sich zu setzen. Langsam hockte er sich neben der Tür auf den Boden, und sofort sprang Herr Arens auf und kam zu ihm. Er musterte ihn besorgt und ging neben ihm in die Knie. Das Kind nahm eine Schutzhaltung ein. Vielleicht durfte es nicht sitzen? Vielleicht musste es in der Ecke stehen? Ob der Mann es schlagen würde? „Möchtest du nicht bei uns am Tisch sitzen?“ fragte der Mann warm, „Das wäre doch ein bisschen komfortabler, oder?“ Bei ihnen am Tisch sitzen? Devlin fielen beinahe die Augen aus dem Kopf angesichts der ungeheuerlichen Einladung. Er durfte am Tisch essen? Unsicher stand er auf und bewegte sich zum Tisch. Er rückte den schönen weißen Holzstuhl zurecht und kletterte hinauf. Frau Arens bemerkte an seinem Gesichtsausdruck, dass er nicht bequem saß und betonte, dass er seinen Schweif zuhause nicht einzwängen musste. Der Junge errötete, aber nach einem weiteren Moment des Hin- und Herscheuerns überwand er seine Scham und zog die ordentlich zusammengerollte Schnecke über den Hosenbund. Als er sie losließ, rollte sie ab, und der Schweif hing an der Seite des Stuhls hinunter. Angela verkniff sich ein Lächeln. Sie fand das Schwänzchen lustig. Es passte irgendwie zu ihm. „Ich kenne da jemanden, der gerne Lasagne isst,“ murmelte die Mutter dann und bat um Devlins Teller. Lasagne? Und er bekam die erste Portion? „Was feiern wir?“ fragte er mit strahlenden Augen, und die Eltern machten überraschte Gesichter. „Dich,“ sagte der Vater, „deine Ankunft hier.“ Devlin schluckte, und seine Augen füllten sich mit Tränen. Sie feierten ihn? „Es gibt sogar Kuchen!“ hielt Angela es nicht mehr aus und lief in die Küche, um umgehend mit einem kleinen runden Schokoladenkuchen zurückzukehren. Er war offensichtlich selbstgemacht, und in der Mitte steckte eine einzelne Kerze. Angela stellte den Kuchen ohne viel Aufhebens neben den Jungen und lachte ihn fröhlich an, „Weil doch irgendwie Geburtstag ist.“ Devlin war sprachlos und murmelte danke. Dann schwieg er, und die Familienmitglieder fragten sich, ob sie übertrieben hatten. Besorgt warteten sie ab, und schließlich fragte er Junge leise, was er tun sollte, „Für das Essen, meine ich.“ Nichts, antwortete die Mutter. „Ich muss nichts dafür machen?“ Das Kind war entgeistert. Die Nonnen hatten ihm eingebläut, dass er für seine Mahlzeiten arbeiten musste! Er war verwirrt, aber er hatte Hunger, und so schaufelte er die Lasagne hinunter, und als er der Schüssel einen sehnsüchtigen Blick zuwarf, bekam er einen Nachschlag, den er ebenfalls verschlang. Zum Nachtisch gab es frisches Obst, und unwillkürlich verzog Devlin seine Mundwinkel zu einem Beinah-Lächeln.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.